Die gefundenen Worte
Bestehend aus dem TW (jm.) berufen (auch als EW verwendet, beispielsweise wie in „berufen sein, etwas zu tun“) und der Endung -ung. Wir verbinden unsere tägliche Arbeit in der Regel immer mit einem Beruf. In der Schule bereiten wir uns auf das Berufsleben vor. Es scheint so, als wäre dies beinahe der wichtigste Teil unseres Lebens, die zentrale Rolle unseres Daseins. Wir sprechen auch davon, unsere Berufung leben zu können. In einer der vielen Bedeutungsebenen des Wortes verstehen wir unter Berufung ein höheres Wirken, etwas, was man unbedingt tun muss und möchte.
Im „Handwörterbuch der deutschen Sprache“ von 1833 lesen wir für das TW berufen folgende Herleitungen und Bedeutungen heraus: „jmd. zu etwas rufen, einladen“, z.B. „die Gemeinde zusammenrufen“, besonders „einen zu einem Amte ernennen“, daher überhaupt „jm. zu etwas bestimmen“; jmd. berufen (zu einer Aufgabe): „einen Beruf dazu habend“, „dazu bestimmt“; auch: „in gutem oder besonders bösem Ruf stehend“; außerdem: sich auf etwas berufen: „mit Worten bezaubern, beschreien (z.B. ein Kind)“
Beruf, der: der Ruf zu etwas (z.B. zu einem Amte)“; auch „die Berufung auf etwas“; Das Berufen zu einem Amte“, „Amtspflicht“ („mein Beruf erfordert es“); im Wörterbuch abschließend und bemerkenswerterweise erwähnt: „der innere Trieb, Beweggrund, die Neigung zu etwas“, „Beruf zu etwas empfinden“. So wurde die Berufung bereits 1833 als etwas verstanden, das einem „inneren Trieb“, einer „inneren Bestimmung“ entspricht, einer „angeborenen inneren Neigung“. Heute nicht mehr gebräuchlich, aber ursprünglich vorgesehen, die aufgeführte Wendung „einen Beruf zu etwas empfinden“
„glücklich machen“;
Unannehmlichkeit, die einen im Herzen traurig stimmt; Gram, Kummer
Gebeugte Form (3. Person Singular Präsens) des Tätigkeitswortes bieten, also veraltet für „bietet“;
er/sie/es beut („er/sie/es bietet“), du beutst („du bietest“) und der Imperativ beut! (biete!) sind in dieser alten Form zu dem Tätigkeitswort bieten, ahd. biotan, bekannt. Bedeutungen sind „bieten, darbieten, in Aussicht stellen, etwas zusichern, etwas reichen, darreichen, jemandem etwas zumuten, jemanden grüßen, einen Gruß erbieten, etwas ankündigen, etwas befehlen oder gebieten“.
gebeut ist die veraltete Form für „gebietet“, also die gebeugte Form des Tätigkeitswortes gebieten, Bedeutungen sind „gebieten, herrschen, befehlen, etwas verlangen, vorschreiben“.
Abgeleitet vom Wortstamm wissen oder gewissen sein, etwas ist „bekannt“; Wissen, das, „Kenntnis, Kunde“. Die eher alltägliche Ebene: „Ich bin mir dessen bewußt“ oder „ein Bewußtsein für etwas entwickeln“, im Sinne: von einem unbewußten Denken und Handeln ablassen, hin zu einem bewußten Wahrnehmen und Agieren, etwas aus dem Un- oder Unter- Bewußtsein ins Bewußtsein holen. In diesem Sinn hat das Wort Bewußtsein sehr viel mit selbständigem Denken, Wahrnehmen und Fühlen zu tun. Andererseits hat dieses Wort eine viel tiefgreifendere Bedeutung, die uns im Allgemeinen auch noch „bewußt“ ist, im Sinne von: ein „neues Bewußtsein“ entwickeln, ein „erweitertes Bewußtsein“ erfahren, bis hin zu einer„Bewußtseinserweiterung“ in Richtung eines „erwachten“ oder sogar „erleuchteten“ Zustandes. Hier betreten wir bereits Neuland, denn was ein „erleuchteter Zustand“ ist, können wir nur ahnend erfassen, solange wir ihn nicht direkt erleben. Wenn wir uns allerdings „bewußt machen“, daß es diese Zustände gibt, werden wir sie auch eher erkennen, wenn wir sie erleben. Mehr und mehr Menschen erleben sie.
Leitet sich von griechisch ta biblía ab für „die Bücher“, und steht für „Heilige Schriften“ bzw. „Heilige Schrift“. Der Begriff umfaßt sowohl die religiöse Textsammlung des Judentums als auch die religiöse Textsammlung des Christentums. Welche Texte zur Heiligen Schrift zählen, unterscheidet sich bei beiden Religionen, wobei jedoch im sogenannten Alten Testament des Christentums die Bücher des Tenach, also die Heiligen Schriften des Judentums, mitaufgenommen wurden. Im Christentum kommen zum Kanon der Bibel noch die Texte des Neuen Testaments hinzu.
Der für Bücher verwendete Papyrusbast stammte im alten Griechenland vornehmlich aus der phönizischen Hafenstadt Byblos. So entstand im Griechischen die Bezeichnung býblos für dieses Rohmaterial, davon dann abgeleitet byblíon / biblíon, für „Papierrolle, Buch“. Die davon gebildete Mehrzahlform biblía (siehe oben) fand Eingang in unser Kirchenlatein und bezeichnete dort dann die Bücher der „Heiligen Schrift“. Dabei wurde das kirchenlateinische biblía als Femininum Singular aufgefaßt und ist so ins Deutsche als die Bibel eingegangen, belegt im Deutschen seit dem 13. Jahrhundert.
(vgl. „DUDEN, Das Herkunftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache“, 3. Auflage, sowie „Wiktionary“ im Internet, unter „Bibel“)
Hölzerner Schlegel zum Klopfen von nasser Wäsche, Schalggerät
Etwas ist so glatt, daß es in der Sonne glänzt
Nhd., „Brunnen, Quelle, Förderanlage für Grundwasser“, auch poetisch genutztes Wort für „Brunnen“; das ahd. Wort Brunno für „Brunnen, Quelle“ findet man bereits im „Chronologischen Wörterbuch des deutschen Wortschatzes / Der Wortschatz des 8. Jahrhunderts (und früherer Quellen)“ von Elmar Seebold; weitere Formen für Born sind beispielsweise: burn(e), mhd.; borne, mnd.; burna, altfries.; burne.
Wir fanden dieses Wort im Gedicht „Der Arbeit Segen“ von Ernst Scherenberg, welches wir in diesem Rundbrief vorstellen, in folgender Zeile:
„Der Born, der Andre labend netzte,
Versiegt’ an seiner Lippe Rand.“
Mit -born als Nachsilbe gibt es viele Wortbildungen: „Jungborn, Kraftborn, Lebensborn, Leidensborn“ sowie „Wissensborn, Zauberborn, Glaubensborn“, welche in ihrer Bedeutung immer den Bezug zu „Quelle“ aufweisen; so hat „Jungborn“ beispielsweise die Bedeutung „Quell der Jugend“.
Wie gut es sich anfühlt, seine Arbeit, seine Berufung oder Bestimmung als „Quell der Freude“, als „Born der Lebensfreude“ im Sinne eines „künstlerischen und sinnstiftenden Schaffens“ bezeichnen zu können! Wir Wortfinderinnen empfinden bei unserem Wirken genau dieses Gefühl und sind dankbar dafür.
Auch in unseren deutschen Ortsnamen findet man sehr häufig das Wort Born, wie beispielsweise in: Paderborn, Borna, Bornstedt, Bornhagen oder Bornhof. Im Buch „Die wahre Bedeutung der deutschen Ortsnamen“ von Rainer Schulz findet man dazu folgende Erklärungen:
„Wie wir u. a. aus der Edda, dem Nibelungenlied oder dem Heliand wissen, ist das Wort Born (gleich dem Lebensborn, sprich die ‚Quelle‘), auch gleichbedeutend ‚Wasser‘, denn ohne Wasser kein Leben. So finden wir heute in hunderten von Orten einen Bornweg oder eine Borngasse, die zu einem bestimmten Platz führt. Wir müssen jedoch aufpassen, ob dort wirklich ein alter Brunnen bzw. eine Quelle liegt oder ob die Urkundenschreiber im Zuge der Christianisierung aus Unkenntnis das Wort Buren (Anm. der Wortfinderinnen: Bur, der, Hauptwort, ahd., ‚Landmann, Nachbar, Bewohner, Bauer‘) mit Born oder ‚Brunnen‘ vertauscht haben. Auch kann es sich um den Versammlungsplatz der Buren handeln. Es muß schon ein Born besonderer Art sein, ein heiliger Born, der immer die Verbindung mit der Thing-Malstatt (Anm. der Wortfinderinnen: Ort der Gerichtsverhandlungen) herstellt.
Die Erzgebirgler nennen heute noch Weihnachten ‚Bornkinnl‘, das Fest des geborenen Kindes. Der Heliand-Dichter nennt Christus ‚godes egan burn‘ (= Gottes eingeborenen Sohn).“
Vielleicht ist es möglich, daß Born nicht nur die Bedeutung einer physischen Quelle innehat, sondern daß der Gehalt dieses Wortes viel umfassender ist und die Bedeutung „geboren, Geburt“ in sich trägt. So wie wir auch im Englischen heute noch das Wort „(to be) born“ für „geboren, geboren werden“ finden. Eventuell ist dieser Sinn der Ursprüngliche, da, wie es Rainer Schulz ebenso beschreibt, es ohne Wasser kein Leben geben kann.
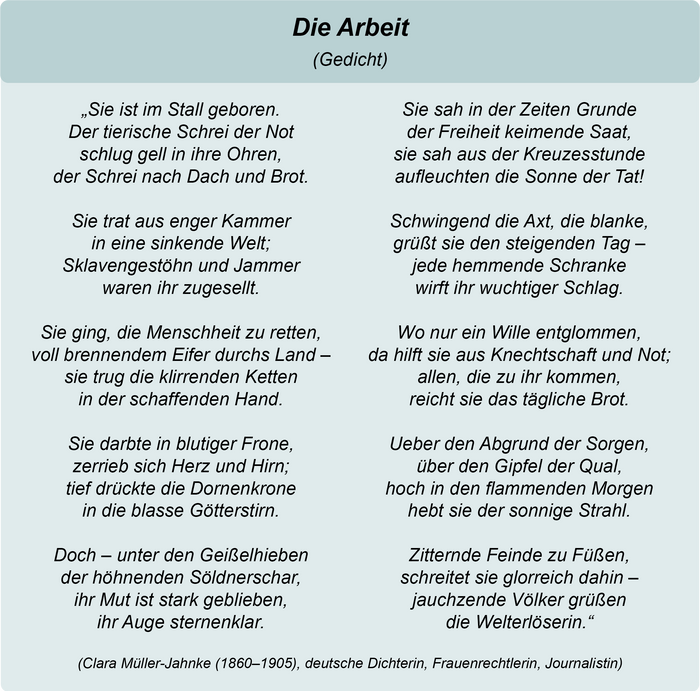
Wir benutzen sie täglich – und doch wissen die wenigsten von uns um ihre ursprüngliche Bedeutung. Wir vermuten: Viele Worte sind der deutschen Sprache in ihrer tief spürbaren Klarheit verlorengegangen, weil ihre Bedeutung verdreht und verändert wurde. Unsere Wortfinderin Christa ist den Ursprüngen der Worte gut, böse und schlecht gefolgt und war wieder einmal erstaunt, was sie im Althochdeutschen bedeuteten: Gut stammt vom althochdeutschen Wort guat ab und bedeutete „in ein Gefüge passend“. Die moralische Bedeutung, welche die Kirche dem Wort gab, hat nichts mehr mit seinem ursprünglichen Sinn zu tun. Böse leitet sich vom althochdeutschen bōsi ab und bedeutete soviel wie „aufgeblasen“ oder „geschwollen“. Etwas Aufgeblasenes passt natürlich auch nicht mehr ins Gefüge. Schlecht, von althochdeutsch sleht, ursprünglich bedeutete es „glatt“, „eben“; schleichen leitet seinen Sinn ab von „leise gleitend gehen“; Bedeutungswandel über die spätmittelhochdeutsche Bedeutung „einfach“, „schlicht“.


